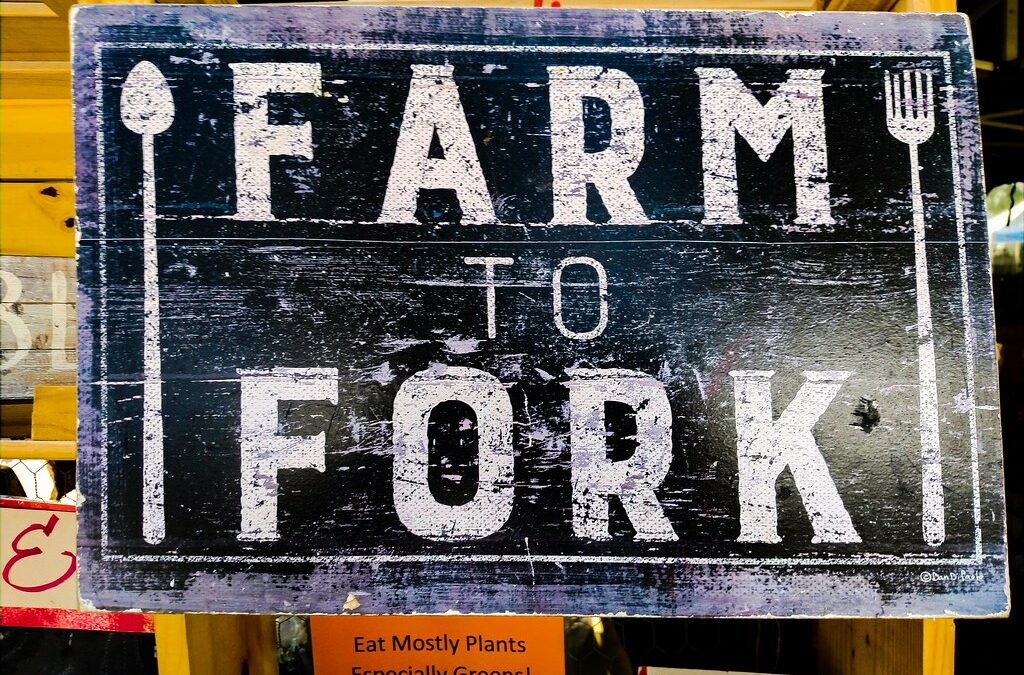Nicht geboren, um nachhaltig zu sein – Teil II
Ein wenig Einsicht kommt auf, der Wille bleibt fern
Viele Reformen, viele Absichten, wenig Erfolge
Die Häufigkeit von „Reformen“ nahm fortan zu. Die sogenannte Agenda 2000 Reform führte den Begriff „Direktzahlungen“ ein und etablierte die heute bekannte „zweite Säule“, die der Förderung des Tierwohls, des Bio-Anbaus, und weiterem dient. Damals betrug der Bio-Anteil der Fläche mickrige 2-3% in der EU. An Verständnis der Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft und Umwelt mangelte es um die Jahrtausendwende jedenfalls nicht, so lässt die damalige EU-Kommissarin für Umwelt, Ritt Bjerregaard, verlauten: „Die Landwirtschaft ist heute wichtig für unsere Bemühungen, Erfolge in Bereichen wie Wasserqualität, biologische Vielfalt und Klimawandel zu erzielen, und die Landwirte sollten zunehmend dafür bezahlt werden, dass sie die öffentlichen Güter schaffen, die die Steuerzahler erwarten. Die Einbeziehung von Umweltbelangen in die GAP darf nicht nur auf dem Papier stehen. Sie muss sich auch in der Realität widerspiegeln.“ Das Problem lag eher daran, schönen Worten auch weitreichende Taten folgen zu lassen, sowie die Gesellschaft grundlegend zu überzeugen.
Die „Fischler Reform“ im Jahr 2003 beschloss die sogenannte „Cross Compliance“, das waren Mindestbedingungen an Landwirte, um Direktzahlungen überhaupt erhalten durften. Das war im Grunde genommen die Kopplung der Zahlungen an Mindeststandards für Umwelt, Tierwohl und Biodiversität. Das klingt zunächst nach einem Schritt in die richtige Richtung, stellt sich aber später noch als irrelevant heraus. Die nächste Reform nannte sich „GAP-Gesundheitscheck“ (2009), schaffte die Milchquote endgültig ab und brachte eine erneute Aufstockung der zweiten Säule, war aber ansonsten auch nicht maßgeblich.
Um die GAP der nächsten Jahre (bis 2027) zu verstehen, lohnt sich besonders ein Blick in die GAP „Reform“ von 2013, die die EU Agrarpolitik von 2014-2022 bestimmte. Ab 2015 wurden 30% der Direktzahlungen an „Greening“-Maßnahmen gebunden, was über der Cross-Compliance hinaus noch zusätzliche Maßnahmen wie Dauergrünland oder Blühstreifen beinhaltete. Mit dieser Illusion sollte die Fortsetzung der flächengebundenen Direktzahlungen legitimiert werden. Dass die GAP ab dem Jahr 2014 kaum Auswirkungen auf Klima und Biodiversität hatte, bestätigt der Europäische Rechnungshof. Selbst der Strukturwandel ließ sich nicht umkehren.
Während von 2003-2013 ein Viertel der Landwirtschaftsbetriebe die Tätigkeit einstellte, brachte auch diese „Reform“ keine Kehrtwende. Und die zweite Säule, die Nachhaltigkeit fördern soll? Für die zweite Säule des GAP-Haushalts war von 2014-2020 weniger als ein Viertel des vorhandenen Budgets vorgesehen. Die Mitgliedstaaten können die zweite Säule ko-finanzieren, doch sie bestimmen selbst, wohin und wieviel Geld fließt. Nationale Regierungen können die Agrarwende somit einfach ausbremsen. Im Jahr 2019 betrug der Flächenanteil an Öko-Landbau in der EU gerade mal 8.5% – ein Armutszeugnis, wenn man die großen Lippenbekenntnisse der Agenda 2000 mit dem trägen Fortschritt und dem Gutachten des EU-Rechnungshofes vergleicht.
Die Reform, die in den Kinderschuhen stecken geblieben ist
Es ist von existentieller Bedeutung, dass wir die Nahrungsmittelproduktion in fit für die heutigen Herausforderungen machen. Das geht nicht, wenn wir Agrarpolitik am Ertrag messen, eine Methode, die letztendlich der verarbeitenden Industrie und Chemiekonzernen zu Gute kommt. Dafür wurde die GAP damals ausgelegt, doch für die Neuausrichtung müssen wir umdenken. Statt wie in den Nachkriegsjahren allein auf die Produktionsmengen zu achten, müssen wir ganzheitlich das Klima zu wahren, Landwirt*innen fair zu entlohnen, und Erzeugnisse gerecht verteilen, um Hunger zu bekämpfen. Denn Erträge haben wir laut der Welternährungsorganisation schon genug, aber die Verteilung ist ungerecht.
Nicht geboren, um nachhaltig zu sein – Teil I
Lesen Sie den ersten teil des Artikels hier!
Ähnliche Artikel
Ähnliche
Newsblog rund um die neue Pestizidverordnung
Als Berichterstatterin arbeite ich an einem neuen Gesetz zur Verringerung von Pestiziden in Europa. Hier findet ihr alle wichtigen Infos und die neuesten Entwicklungen zur SUR. Belastete Gewässer und Böden, schwindende Biodiversität, aussterbende Insekten und...
Burger aus der Petrischale
Was steckt hinter In-Vitro-Fleisch?Auf der Suche nach ökologischen Lösungen für unser Ernährungssystem wird seit neuestem eine weitere Möglichkeit diskutiert - Essen aus dem Labor. Aber können Kunstfleisch und Co. halten, was sie versprechen?Der Status QuoDass unsere...
Umwelt-Krimi vor der Sommerpause
Ein „Ja“ zur Natur - wie der konservative Kreuzzug gegen das Gesetz zur Rettung der Natur gescheitert ist.Zittern bis zur letzten Sekunde: schaffen es die europäischen Konservativen im Schulterschluss mit der Rechten, ein Herzstück des Europäischen „Green Deals“ zu...